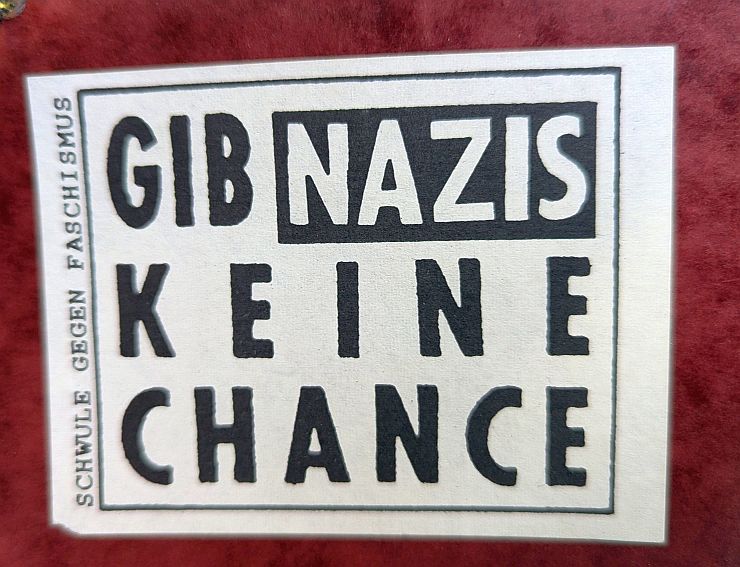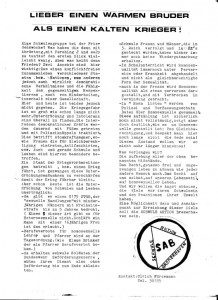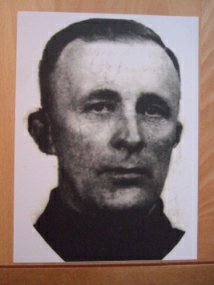Der Film Oi! Warning der Brüder Reding ist ein auch queerer Independent Film über Aussteigen, über Skins und Punks, über Männlichkeitsphantasien, Autonomie und Träume. Er erzählt eine auch heute sehr sehenswerte coming of age Geschichte.
Janosch, siebzehn Jahre alt, haut ab. Verlässt seine Freundin, seine Mutter, das Zuhause am Bodensee. Mit dem Roller auf nach Dortmund zu seinem langjährigen Freund Koma, den er schon von der katholischen Landjugend kennt. Koma und Janosch, Hauptfigur des Films, steigen aus ihren bisherigen Lebenswelten aus. Raus aus kleinbürgerlichem Mief – alles, nur das nicht.
Koma trainiert hart Thaiboxen. Das für ihn mehr ist als Sport. „Gleich allemachen. Nicht so halbe Sachen!“ Und Koma ist inzwischen überzeugter Skin geworden. „Parole Spaß – Mal zum Kühlschrank, mal zum Klo, sonst nur Rummachen. Wochenlang.“
Janosch ist begeistert von Koma und dessen Verwandlung. Blicke die auch Begehren erahnen lassen. Janosch folgt Koma, wird auch zum Skin. Ist Janoschs Begeisterung für Koma mehr als freundschaftlich? Seine Blicke scheinen es anzudeuten. Er wohnt zunächst bei Koma und dessen Freundin, übernimmt dessen Gewohnheiten, Klamotten, Stil. Doch beim Tätowierer trifft er zufällig auf Zottel, einen Punk, dessen Tattoo er bewundert. Zottel, eher das Gegenteil von Koma, beginnt ihn zu faszinieren, als er sieht wie dieser bei Blancas Geburtstag die Gäste mit Feuerspucken unterhält. Das will er auch lernen. Janosch besucht Zottel in seinem Bauwagen.
„Was hat keine Haare und kann nur ein Wort?“ (Zottel)
„Oi! – Ein Skin!“ (Janosch)
„Was hat Stachel und kann schon vier Wörter? – Haste ma ne Mark?“
„Ein Punk!“

Janosch und Zottel, der Möchtegern-Skin und der Punk – finden sie zusammen?
„Hey, das is nicht so dein Ding, Dreck Matsch Pampe – aber ich mag das.“ (Zottel zu Janosch)
.
Männerphantasien, latent gewaltbereites Verhalten, Saufen Gegröle und verzerrte Gesichter, aggressive Kumpelhaftigkeit, Frauen die als Zuschauerinnen und Sexobjekte degradiert sind. Der Film zeigt Skinheads, die eher nicht politisch motiviert sind. Und doch eine Skin-Szene die wie eine eingeklemmte letzte Bastion abgestandener gewaltaufgeladener Männlichkeitsphantasien wirkt.
Der Punk Zottel wirkt hier geradezu als Gegenentwurf. Aussteiger auch er, doch auf eine fast verträumte Weise, friedlich, gelegentlich zärtlich, voller Phantasien und Träume. Wo der Skin Koma von Gegröle der Kameraden begleitet bei einem Boxkampf auf einen Unbekannten einprügelt, wird im Gegenschnitt Janosch gezeigt, Zottel beim Jonglieren beobachtend, begleitet von Vogelgezwitscher im Freien auf einer Obstwiese.
Die unterschiedlichen Freiheits-Entwürfe von Skin und Punk, hier fast Proll-Skin und Romantik-Punk, sie sind neben dem Verhältnis von Aussteigen und Gewalt eines der Themen des Films. Dass Koma zum Schluss der Box-Szene KO auf die Bretter geht und seinen Boxkampf verliert, wirkt hier wie ein didaktischer Regie-Kommentar, der dieser Deutlichkeit nicht einmal bedurft hätte. Koma hat mehr als nur einen Boxkampf verloren …
.
Dominik und Benjamin Reding bereiteten den Film Oi! Warning fünf Jahre vor. Sie drehten mit Laien aus lokalen Skin- und Punk-Szenen und wenig erfahrenen Schauspielern. Die Dreharbeiten fanden in Hamburg, Bochum, Hagen, Iserlohn, Haltern, Dortmund, Lindau und am Bodensee statt.
Die Musik in Oi! Warning ist u.a. von Terrorgruppe (1993 – 2005, 2014; Deutschpunk / Aggropop, Berlin) und Smegma (1992 – 2000; am Bass der spätere Audiolith-Gründer Lars Lewerenz; unpolitischer Oi!-Punk, die Band äußerte sich immer wieder deutlich gegen rechts; im Film Auftritt unter dem Namen „rOi!mkommando„).
Oi! Warning wurde bei seinem Kinostart 2000 sehr kontrovers aufgenommen. Grobkörnige Gewaltästhetik, Selbstfindung in schwarz – weiß, Handlungsstränge und Figuren holzschnittartig gestrickt. ‚Prädikat wertvoll‘, urteilte die FBW.
Nach seinem Kinostart in Deutschland im Jahr 2000 wurde der Film – obwohl die Skins bei Oi! Warning unpolitische sind – als Teil der Debatten über den Umgang mit neonazistischen Tendenzen wahrgenommen. Mehrere Diskussionsveranstaltungen mit den Regisseuren in ostdeutschen Bundesländern mussten nach massiven Drohungen aus rechtsextremen Kreisen abgesagt werden, andere wurden niedergeschrieen.
„Was wir erreichen wollten ist, dass sich der Otto-Normal-Verbraucher fragt, wie eigentlich Homophobie entsteht und an welcher Stelle ein unpolitischer zu einem homophoben Mörder wird und das Opfer ein toller, queerer Mensch ist.“
Dominik Reding, zitiert nach Homopunk History
Das Schlammbad im Film Oi! Warning hat ein reales Vorbild und politischen Hintergrund … den ‚Rattenwagen‘ beim CSD 1997 …
Und schwule Szenen entdeckten den Schlamm als Fetisch …

Oi! Warning als Schritt in die Welt des filmischen Umgangs mit Aids in Zeiten der Normalisierung
Das Schlammbad, das Zottel kurz vor Schluss des Films nimmt, und die hier noch offene Frage, ob das tatsächlich ’nicht so Janoschs Ding‘ ist, sie sind einer der zentralen Momente in der Darstellung der Beziehung zwischen Janosch und Zottel. Ein sexuell aufgeladener Moment – mit Hintergrund.
Gerade dem Schlammbad des Films kommt auch im Kontext schwule Sexualität und Aids eine besondere Bedeutung zu. Philipp Meinert berichtet in Homopunk History im Kontext des Rattenwagens 1997
Der lustvolle Umgang mit Dreck war laut Benjamin [Reding; d.Verf.] auch eine Antwort auf die endlosen Safer-Sex- und Reinheits-Diskussionen in denen z.B. ernsthaft darüber gestritten wurde, ob es beim ’safer‘ Küssen zum Speichel-Austausch kommen dürfe.“
Schlamm und Lust am Dreck als Kontrast, ja Kontrapunkt zu Sterilität und Reinheit.
Ende der 1990er Jahre. Wirksame Aids-Medikamente stehen (in Industriestaaten) breiter zur Verfügung. Aids beginnt nicht länger tödliche Drohung zu sein. Ein coming of age Film in dem Aids nicht stattfindet. Ein selbstbewusster junger Schwuler badet im Schlamm. Er genießt lustvoll Dreck Siff Matsch Unreinheit. Das ganze Gegenteil der sterilen reinen sauberen risikobefreienden Welt der Prävention. Lust und Dreck statt Reinheit und Angst.
Auf diese Weise gelesen kann Oi! Warning wenn auch nicht als früher post-Aids- Film, so doch als wichtiger filmischer Schritt der Befreiung, eines anderen (vor allem auch: weniger dominanten) Umgangs mit dem Thema Aids gelesen werden.
.
„War einmal ein kleines Schwein
das grunzte frech und dreckig
…
und wenn es nicht gestorben ist
dann grunzt es noch heute
und wühlt mit Lust im Matsch herum
und versaut die braven Leute“
.
Oi! Warning (aka: Oi! Warning – Leben auf eigene Gefahr; Arbeitstitel Fettes Gras)
Deutschland 1999, schwarz/weiß
Regie, Drehbuch & Produktion Benjamin & Dominik Reding
Erstaufführung 11. Juli 1999 (Los Angeles Outfest, Gay and Lesbian Film Festival)
Erstaufführung Deutschland 16. Februar 2000 Berlin, Berlinale (noch ohne Off-Kommentar von ‚Janosch‘)
Kinostart Deutschland 19. Oktober 2000
auch 2019 weiterhin als DVD erhältlich
ausgezeichnet mit
Outstanding Emerging Talent (Dominik & Benjamin Reding) – Los Angeles Outfest 1999
Max Ophüls Preis (Dominik & Benjamin Reding) – Max Ophüls Festival 1999
Lobende Erwähnung Kamera Spielfim (Axel Henschel) – Deutscher Kamera-Preis 1999
Filmpreis des DGB – Internationales Filmfest Emden 2000
Le Prix Spécial du Jury – 17. Festival International du premier Film d´Annonay 2000
Main Jury Award / Best Feature Film – Mezipatra, Czech Gay and Lesbian Film Festival 2003