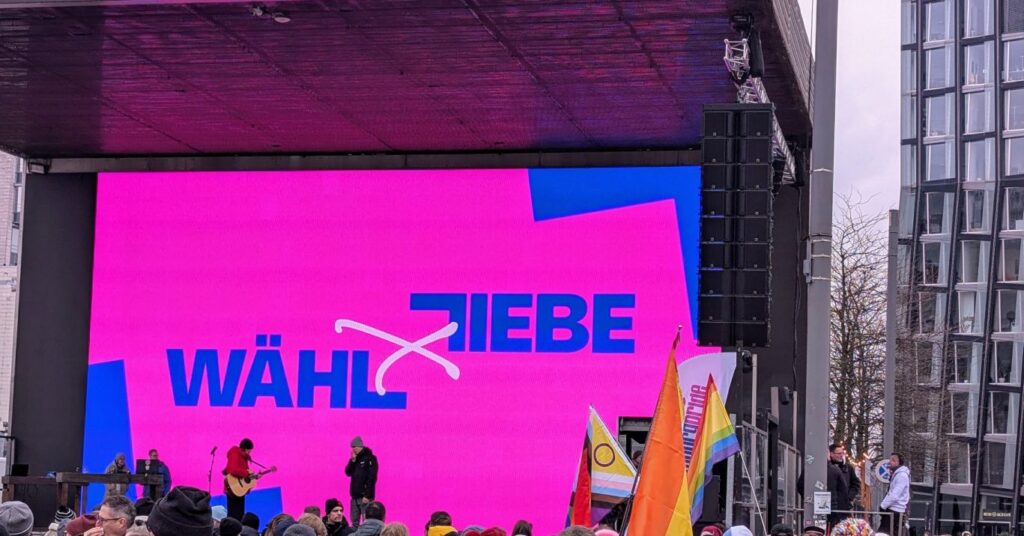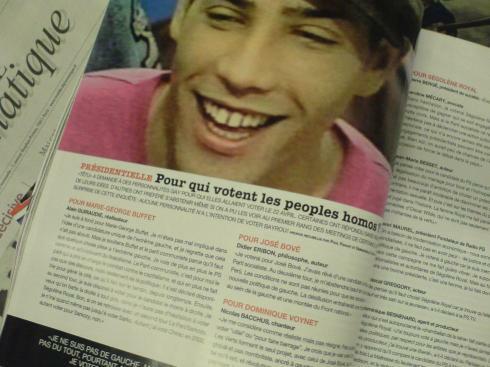Das Oberlandesgericht Oldenburg (damals geleitet von Ekhard Koch (1902 Jever – 2000 Oldenburg)) entschied 1946, dass die Paragraphen 175 und 174a Nazi- Unrecht seien.
Urteil des OLG Oldenburg vom 15.4.1946 (SJZ 1946, 96) (HESt 1, Nr. 131, S. 295 – 298)
Ähnlich urteilten die OLGs Braunschweig und Kiel 1947 (vgl. Herzer 1990).
Bei der Rechtsbereinigung mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 55 (20. Juni 1947) wurden diese dann jedoch nicht in die Aufhebungsanordnung einbezogen.
„Zunächst ist zu bedenken, dass nach 1945 in erster Linie nur die Judenverfolgung und „herrisches Gehabe“ als spezifisch nationalsozialistisch galten. Die Verfolgung von Homosexuellen, politischen Gegnern, „Asozialen“sowie die Sterilisation von Geisteskranken z.B. wurden nicht als nationalsozialistisch begriffen.“
Peter Bahlmann, Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Wiederaufbau der Justiz und frühe NS-Prozesse im Nordwesten Deutschlands. Dissertation, 2008