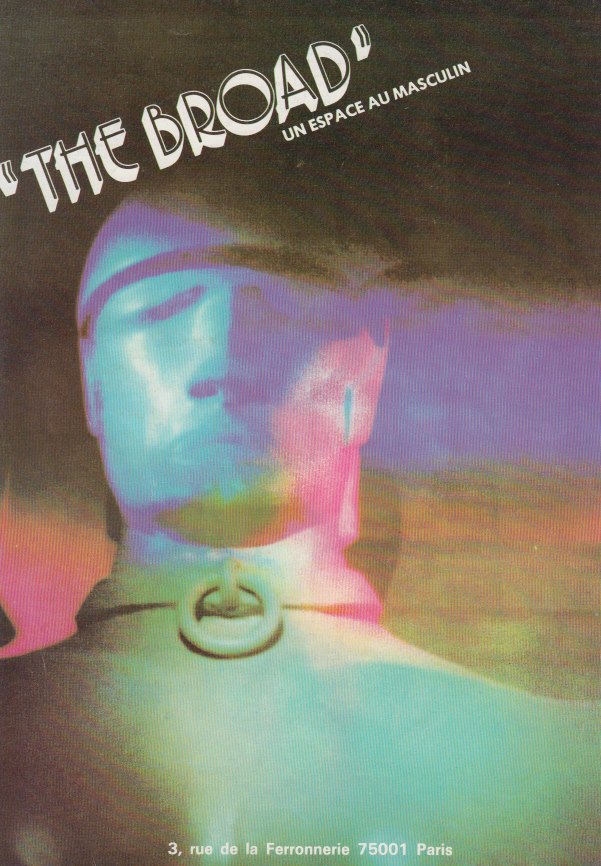Die Discothek Etzhorner Krug wurde 1975 als Discothek eröffnet – zuvor war es lange ein ‚gutbürgerlicher‘ Landgasthof und ein Ausflugslokal, in einem ehemaligen Zollhaus an der Butjadinger Strasse im Oldenburger Stadtteil Etzhorn..
Wim Frank und Udo Wellmann eröffneten 1975 das was damals ‚progressive Disco‘ genannt wurde. Geöffnet war an drei Tagen die Woche (Fr, Sa & ?) ab 21:00 Uhr bis 3 Uhr nachts, soweit ich mich erinnere kein Eintritt und kein Mindestverzehr.
Der Etzhorner Krug hatte einen sehr großen hohen Saal mit einer Bühne, auf der gelegentlich Konzerte stattfanden (u.a. Trio, Inga Rumpfs Atlantis).
„Kralle Krawinkel [Gitarrist von Trio, UW] wohnte ja damals mit Mick Kaiser [dem Wirt des legendären Wally in Bremerhaven, UW] im Friedhofsweg 1″ [beide spielten in der 1969 gegründeten norddeutschen Rockgruppe ‚Cravinkel‚
Ulli Brinkhaus 2006 (quelle )
Der Krug hatte eine sehr gute Sound- und Licht-Anlage. Vertrocknete Birken, von Strahlern angestrahlt, standen im Saal.
Die DJs (u.a. Ulli Brinkhaus, Otto Sell) befanden sich ab 1980 auf einer Empore über der Theke (erreichbar über eine Treppe links der Theke)
.
Der Etzhorner Krug hatte fast von Beginn an Ärger mit Nachbarn. Gelegen nahe einem Wohngebiet, hatte der Krug keine volle Discotheken-Lizenz, sondern nur eine Lizenz als Ausschank mit Gelegenheits-Tanz. Zwar konnte der Wirt auf dem Parkplatz für Ruhe sorgen, immer wieder beschwerten sich jedoch Nachbarn über Ruhestörung durch Disco- und Konzert- Gäste, erzwangen später sogar Schallschutz-Gutachten.
Im September 1981 (kurz nach einem Inga Rumpf Konzert) wurde der Etzhorner Krug geschlossen.
Nach langem Leerstand und Besitzerwechsel (1998/99) wurde das inzwischen baufällige Gebäude abgerissen. Heute befindet sich hier ein in optischer Anlehnung an das historische Gebäude neu gebauter Hotel- und Restaurant-Komplex.
.
Neben dem Rockpalast in Delmenhorst war der Etzhorner Krug ‚Lieblings-Disco‘ … so wie bald darauf das Wally in Bremerhaven …
siehe auch umsonst & draußen Wardenburg 1980
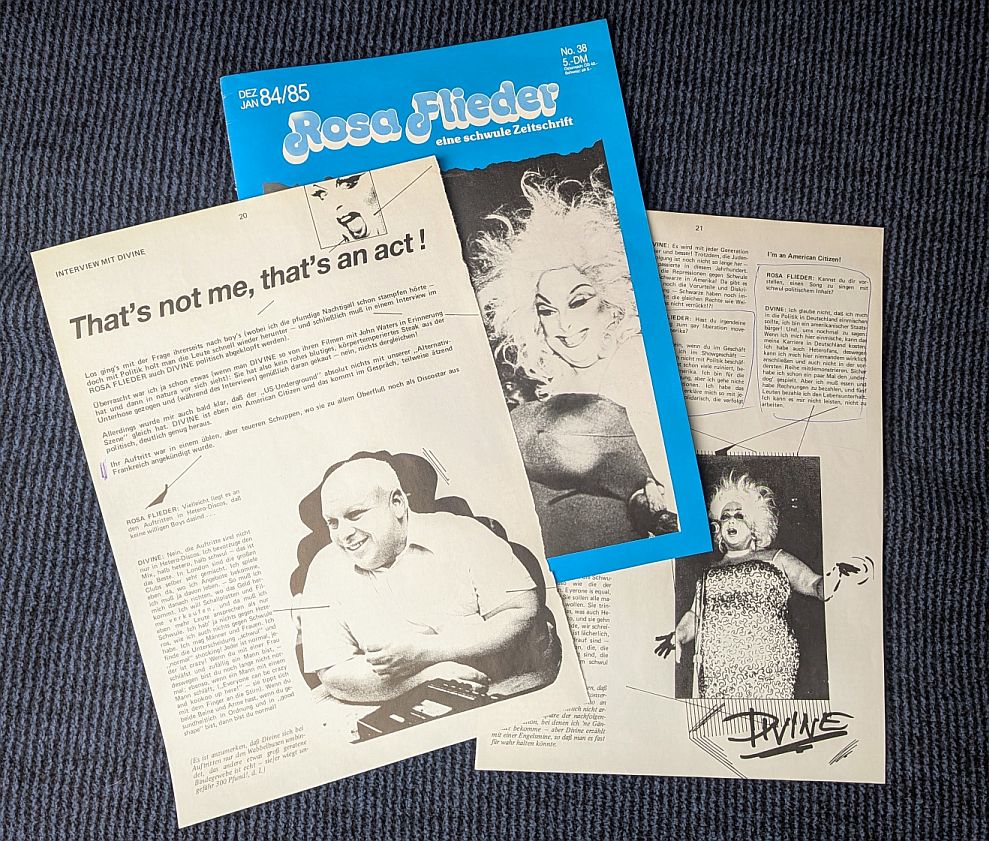
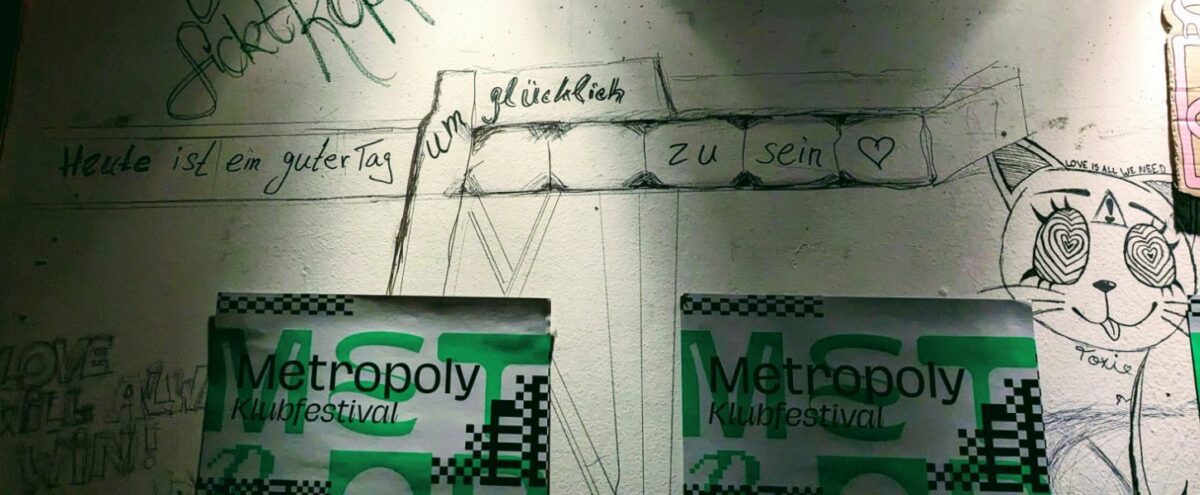
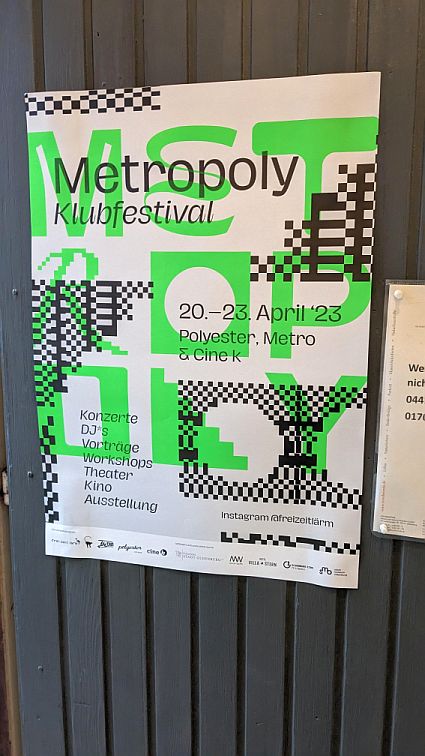



![Dorfdisco in der DDR 1987 [ADN-ZB Bartocha 11.2.87 Bez. Neubrandenburg: Nienhagen - Patendorf der FDJ- Disco in der Dorfgaststätte ist eine der neuesten Errungenschaften für die jungen Leute in Nienhagen. Die Gaststätte "Am Ziegenmarkt" ist Eigentum der LPG. Sie gehört im weiten Umkreis des Dorfes zu denen, die keine Konkurrenz zu scheuen brauchen. Die Einrichtung wird von einem Ehepaar betrieben, das aus dem Bezirk Dresden kam und eines der neuen Eigenheime bezog. - siehe auch 1987-0211-9 und 10N -; Foto Benno Bartocha, Bundesarchiv, Bild 183-1987-0211-008 / CC-BY-SA 3.0]](https://www.2mecs.de/wp/wp-content/uploads/2017/06/Bundesarchiv_Bild_183-1987-0211-008_Nienhagen_Blick_in_die_Dorfdisco.jpg)