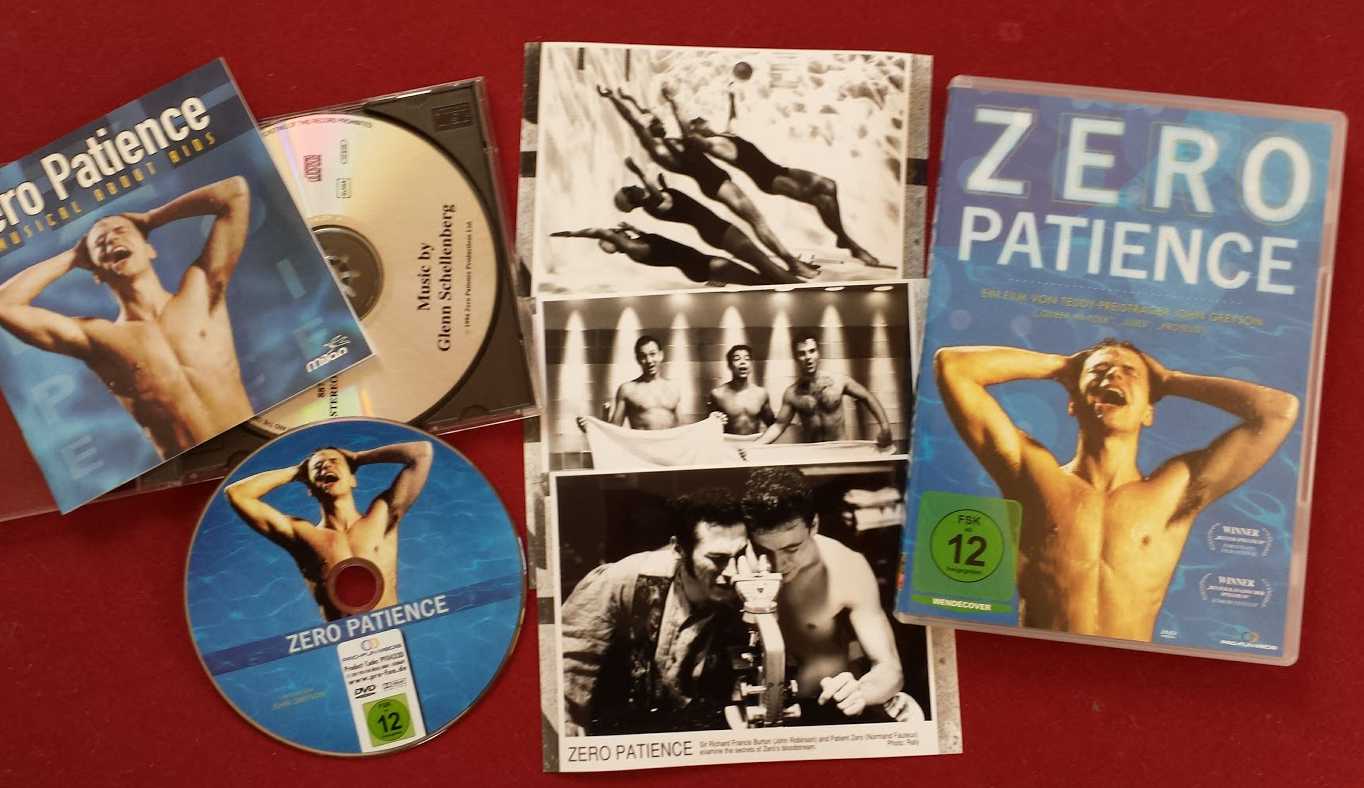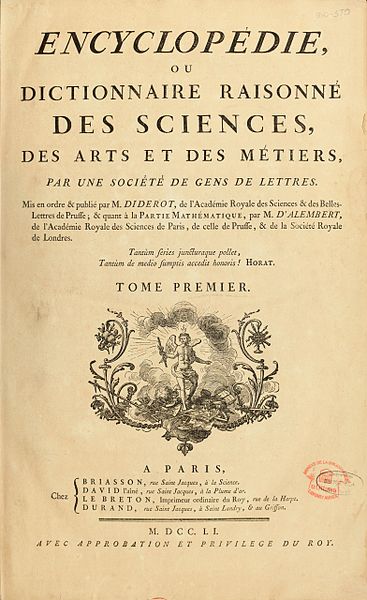Der französische Theaterintendant, Regisseur, Autor und Schauspieler Patrice Chéreau (1944 – 2013) war ein Geschichtenerzähler – ob im Film, im Theater oder in der Oper.

Patrice Chéreau
Patrice Chéreau wurde am 2. November 1944 in Lésigné im Départment Maine-et-Loire geboren. Er war introvertierter junger Mann – der in der Bühne seinen Weg fand sich auszudrücken
„Tout à coup, je découvrais que je savais organiser, que je savais conduire. J’avais de l’invention sur scène, alors que je n’en avais pas dans la vie. Le théâtre a été un contrepoison au malheur, à la solitude que je portais en moi.“
( „Ich entdeckte dass ich organisieren kann. Auf der Bühne kamen mir die Ideen, die ich im Leben nicht hatte. Das Theater war ein Gegengift für das Unglück, die Einsamkeit, die ich in mir trug.“)
Spätestens seit seinem Germanistik-Studium an der Sorbonne finden sich in sienem Werk und Leben immer wieder Bezüge zu Deutschland
Chereau übernahm mit 22 Jahren die Leitung des Theaters von Sartoruville, die er von 1966 bis 1968 inne hatte.
1972 bis 1981 war er Ko-Direktor (gemeinsam mit Robert Gilbert und Roger Planchon) des TNP (theatre nationale populaire) in Villeurbanne (dessen Direktor 1951 – 1963 der legendäre Intendant und Volkstheater-Impressario Jean Villar war).
1993 wurde er mit Goethe-Medaille sowie Friedrich-Gundolf-Preis ausgezeichnet.
Patrice Chéreau starb am 7. Oktober 2013 im Alter von 68 Jahren in Clichy an den Folgen von Lungenkrebs. Er wurde in Paris auf dem Friedhof Père-Lachaise (16. Abteilung, Chemin de La Bedoyère) beigesetzt.

In Nanterre wurde der Platz vor dem neuen Bahnhof Nanterre Université nach Patrice Chéreau benannt.
Patrice Chéreau – L’Homme blessé (1983), legendärer Film über Jugend und Leidenschaft
1983 realisierte Patrice Chéreau den Film ‚L’Homme blessé‚, für den er gemeinsam mit Hervé Guibert auch das Drehbuch verfasste.
L’Homme blessé, produziert vom Filmregisseur und -Produzenten Claude Berri (1934 – 2009), ist Chéreaus dritte Regiearbeit nach La Chair de l’Orchidée (1975) und Judith Therpauve (1978). Uraufführung war bei den Filmfestspielen in Cannes am 18. Mai 1983, deutsche Erstaufführung (UT) am 2. August 1985.
Im März 1984 erhielten Chéreau und Guibert den César für das beste Drehbuch für den Film (beide sollen seit 1976 an dem Projekt gearbeitet haben).
Henri, ein junger Mann von 18 Jahren (dargestellt von Jean-Hugues Anglade, später u.a. in ‚Die Bartholomäusnacht‚), entdeckt seine Homosexualität über die Bahnhofs-Stricherszene. Flieht er vor den Blicken des Begehrens, oder sucht er Kontakt zu anderen Männern? Der Enge seines Elternhauses entkommend, sich befreiend, entdeckt er Gelüste und Begierden in seltsamer Alliance mit einem älteren Herren, Verführung und Prostitution.
„L’homme blessé‘ était un film courageux.“
Jean-Hugues Anglade 42 Jashre später im November 2025 über den Film
Auf eigentümliche Weise erinnert Chéreaus Film, gerade in der Darstellung des älteren Mannes, phasenweise an Jean Genet.
„Die Jugend vieler von uns hatte so etwas wie ein abgerissenes Glitzern; und dann gab es eben jenen geheimnisvollen Glanz einiger weniger, die wirklich strahlten, jener Jungen, deren Körper, Blicke und Gesten eine Anziehungskraft enthielten, die uns zu ihrem Spielzeug machten. So wurde ich von einem dieser Männer wie vom Blitz getroffen.“
(Jean Genet, Tagebuch eines Diebes)
Chéreau sprach später über den Film
„A l’epoque où j’ai fait L’Homme blessé, j’ai voulu clairement faire un film qui parlerai de la passion d’un garçon pour un autre. … j’ai eu l’impression d’y avoir mis tellement de moi-même que je me suis senti comme éventré.“
(‚Zu der Zeit als ich L’Homme blessé drehte wollte ich einen Film machen der von der Leidenschaft eines jungen Mannes für einen andere erzählt. … ich hatte den Eindruck dermaßen viel von mir selbst gezeigt zu haben, dass ich mich ausgeweidet fühlte.‘)
Hervé Guibert, Ko-Autor des Drehbuchs, bemerkte im (damals legendären Schwulenmagazin) Gai Pied über L’homme blessé 1983
„L’Homme blessé est un film qui dérange, est inhabituel, c’est un film qui ne resemble pas à un film français, qui a des violences peut-être insupportables, qui est très brutal.“
(Hervé Guibert 1983)
(L’homme blessé ist ein Film der ungewöhnlich ist, der stört. Ein Film der nicht an einen gängigen französischen Film erinnert, der sehr brutale, vielleicht unerträgliche Gewaltszenen hat.)
Jean-Hugues Anglade, einer der beiden Hauptdarsteller (seine erste ‚große‘ Rolle), äußerte später über den Film:
„il envisage enfin le cinéma non plus comme une convention artistique nouvelle, mais comme un outil susceptible de mettre en scène son univers d’homme“
(Jean-Hughes Anglade)
(Er betrachtet das Kino nicht mehr als neue künstlerische Konventiopn, sondern wie ein Werkzeug, um sien männliches Universum zu inszenieren.)
L’Homme blessé – ein Film aus einer Zeit vor Aids
Chéreau selbst kommentierte
„L’Homme blessé est un film que je ne ferais plus du tout de la même façon, c’est un film d’avant le sida, c’est un film impossible à faire maintenant. Je ne filmerais plus les toilettes de la gare du Nord. C’est devenu impossible.“
(‚Den Film L’Homme blessé würde ich heute so nicht mehr drehen. Er ist ein Film aus der Zeit vor Aids. Unmöglich ihn heute so zu machen. Ich würde die Toiletten im Gare du Nord nicht mehr filmen. Das ist unmöglich geworden.‘)
Später sagt Chéreau über Aids
„J’ai mis un temps, à mon avis anormal, à comprendre que le sida n’était pas une maladie comme les autres, puisqu’elle se mettait à toucher spécifiquement tous nos amis. C’est seulement maintenant que je commence à le comprendre, alors que nous avons tous les carnets d’adresses qui sont remplis de gens dont on ne sais pas s’il faut laisser le nom, rayer, retirer …“
(‚Ich brauchte lange, meiner Meinung nach abnormal lange, um zu verstehen dass Aids nicht eine Krankheit wie jede andere ist, weil sie begann ganz spezifisch all unsere Freunde zu betreffen. Erst jetzt beginne ich zu verstehen, wo wir doch alle Adressbücher haben mit Leuten von denen man nicht weiß ob wir den Namen stehen lassen oder streichen sollen.‘ (Übers. UW))
der politische Patrice Chéreau
Chéreau zeigte immer auch politisch Haltung. Bei den Wahlen 1981 und 1988 z.B. rief er zur Wahl von Francois Mitterrand auf, unterstützte in späteren Jahren Lionel Jospin, Ségolène Royal und Martine Aubry.
Als in Österreich die rechtsgerichtete FPÖ an der Regierung beteiligt wurde, boykottierte Chéreau (der auch als Opern-Regisseur arbeitete, vgl. Bayreuth ‚Ring‘) die Salzburger Festspiele.
Patrice Chéreau – Privatleben
1987 lernt Chéreau im Marais den Schauspieler Pascal Greggory (geb. 8. September 1954) kennen. Gregory war zuvor u.a. durch seine Zusammenarbeit mit André Téchiné (‚Die Schwestern Brontë‚, 1979; später ‚Les Témoins‘ / Wir waren Zeugen, 2007) bekannt geworden.
Chéreau und Greggory werden ein Paar. Sie arbeiten bei mehreren Filmen (u.a. ‚Die Bartholomäusnacht‚ (Greggory als Herzog von Anjou), ‚Wer mich liebt nimmt den Zug‘, s.o.) (1998; Greggory nominiert für den César Kategorie Bester Schauspieler) und Bühnenstücken zusammen.
Im folgenden Video erzählt Greggory über seine Arbeit mit Téchiné und seine Zeit mit Chéreau
.
1983 ‚L’Homme Blessé‚ (dt. ‚Der verführte Mann‘), Drehbuch Chéreau und Hervé Guibert
1994 ‚La Reine Margot‚ (dt. ‚Die Bartholomäusnacht‘)
1998 ‚Ceux qui m’aiment prendront le train‚ (dt. ‚Wer mich liebt nimmt den Zug‘; letztere beide im offiziellen Wettbewerb in Cannes)
.
Patrice Chéreau und André Téchiné, beide als Erben der bzw. ‚Post Nouvelle Vague Generation‘ tituliert, waren Teil eines französischen Kultur-Kanons, in dem ab den 1980er Jahren die Sichtbarkeit von Schwulen und von Homosexualität im Film Bestandteil war. Beide folgten je auf ihre eigene Weise auf Pasolini und Fassbinder.
Die FAZ schrieb 2003 anlässlich der Premiere von Chéreaus Film ‚Sein Bruder‚ (Silberner Bär, Berlin 2003) (bei dem, nebenbei bemerkt, einige Kritiker neben Bezügen zu Hervé Guibert auch Bezüge zu Téchinés wunderbarem Film ‚Les Temoins‘ anmerkten)
„Sein Bruder“ ist so spröde, wie es die Filme von Andre Techine manchmal sein können, die ähnlich mitleidslos sind, weil sie auf falsches Mitgefühl pfeifen.
FAZ 2003
.
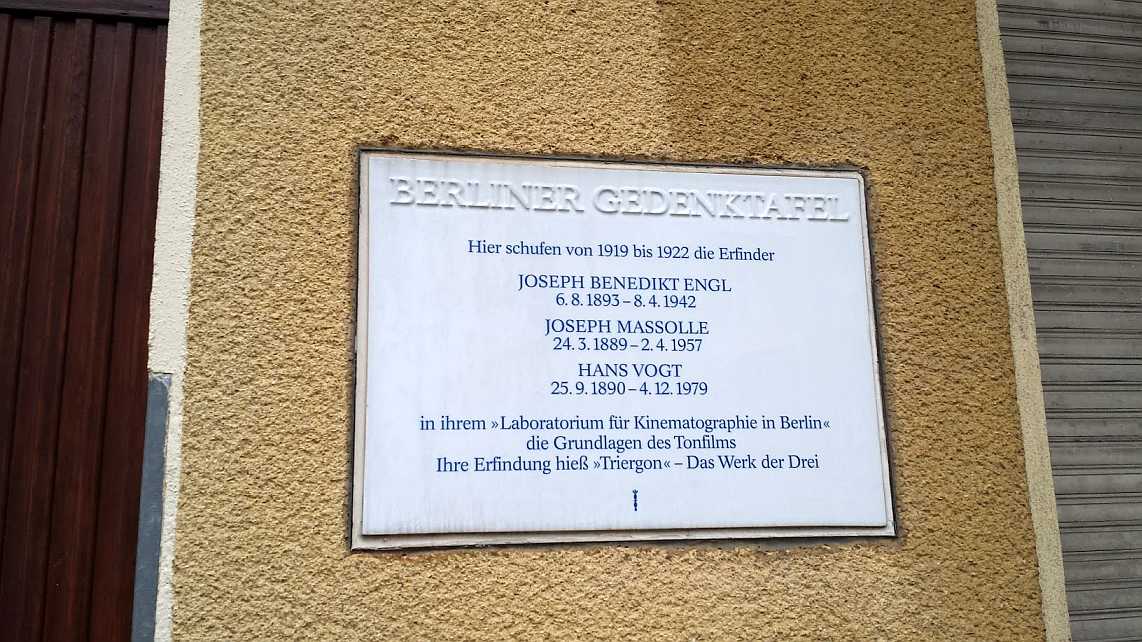
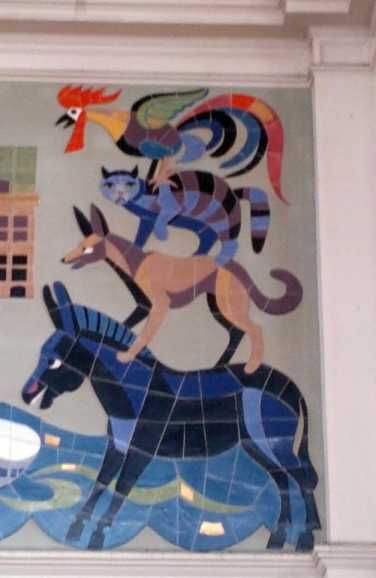
![Barbara, Auftritt Grand Gala du Disque Populaire 1968 [Jac. de Nijs. Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 - negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.05, bestanddeelnummer 921-1453; Lizenz cc-by-sa 3.0 nl]](https://www.2mecs.de/wp/wp-content/uploads/2017/11/Barbara.jpg)

![Dorfdisco in der DDR 1987 [ADN-ZB Bartocha 11.2.87 Bez. Neubrandenburg: Nienhagen - Patendorf der FDJ- Disco in der Dorfgaststätte ist eine der neuesten Errungenschaften für die jungen Leute in Nienhagen. Die Gaststätte "Am Ziegenmarkt" ist Eigentum der LPG. Sie gehört im weiten Umkreis des Dorfes zu denen, die keine Konkurrenz zu scheuen brauchen. Die Einrichtung wird von einem Ehepaar betrieben, das aus dem Bezirk Dresden kam und eines der neuen Eigenheime bezog. - siehe auch 1987-0211-9 und 10N -; Foto Benno Bartocha, Bundesarchiv, Bild 183-1987-0211-008 / CC-BY-SA 3.0]](https://www.2mecs.de/wp/wp-content/uploads/2017/06/Bundesarchiv_Bild_183-1987-0211-008_Nienhagen_Blick_in_die_Dorfdisco.jpg)