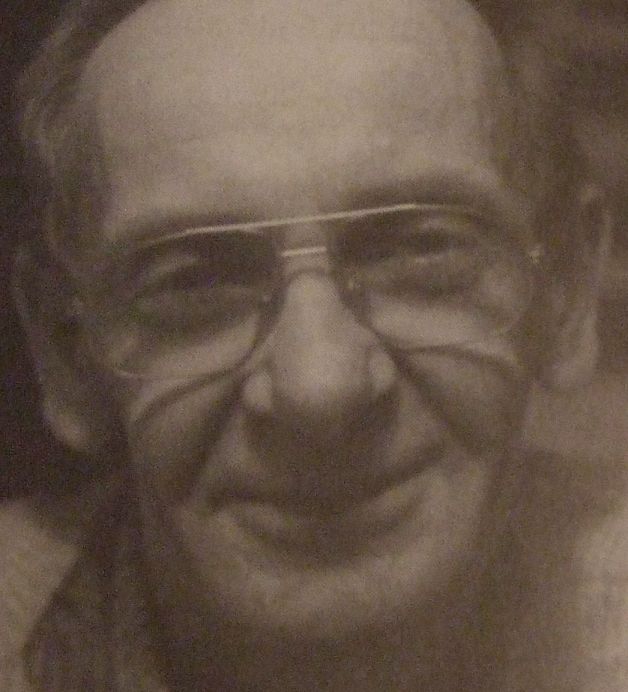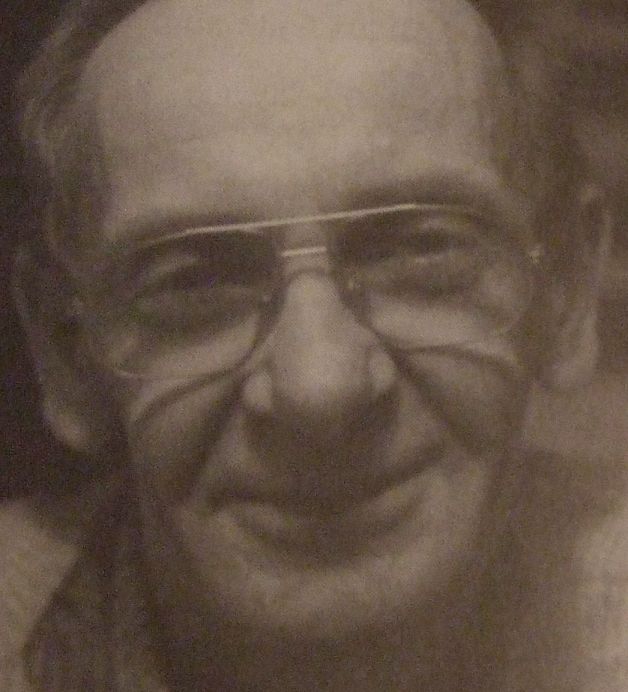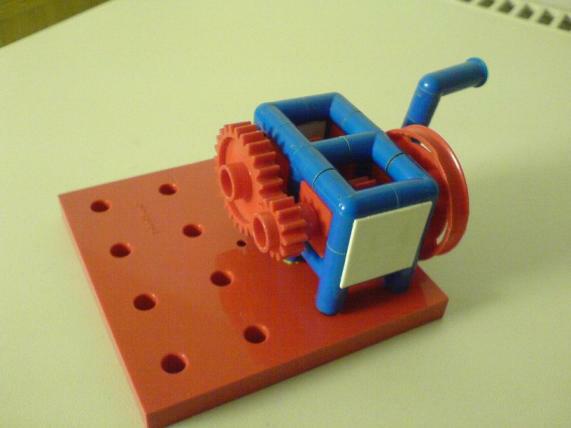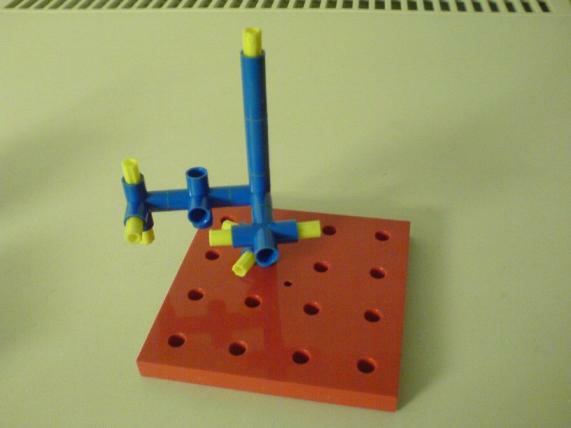„Habt ihr nicht Lust zu Weihnachten nach Paris zu kommen?“
Jean-Philippe wirkt am Telefon aufgeweckt und voller Energie.
Oh, wie sehr ich Lust hätte! Endlich Jean-Philippe wieder sehen. Aber – schlechtes Gewissen plagt mich. Bildet mit Sehnsucht eine eigenartige Melange.
Jean-Philippe lag in der Klinik, erst vor kurzem, Lungenentzündung. Und ich hab mich nicht getraut, ich feiger Hund. Ich hatte Tage gebraucht, bis ich auch nur halbwegs kapierte, welche Ängste mich da plagten, mir nicht nur dem Magen umdrehten – und als ich’s halbwegs gerafft hatte, nicht nur wusste, du kannst deinen Freund Jean-Philippe nicht im Stich lassen, sondern auch wusste, ja, du kannst das, du hältst das aus – da war er schon wieder entlassen.
„Geht leider nicht, wir sind schon bei Franks Eltern in Hamburg eingeladen. Die wären bestimmt sauer, wenn wir da so kurzfristig absagen.“
Zu gerne würde ich ja nach Paris fahren ….
„Ja, und warum kommt ihr dann nicht hinterher, zum Beispiel zu Silvester? Dann könnten wir doch schön gemeinsam ins neue Jahr feiern!“
Ja – warum eigentlich nicht?
~
30. Dezember. Morgen ist Silvester, und Jean-Philuippe und Syriac haben immer noch nicht verlauten lassen, wie sie sich die Silvesternacht vorstellen.
„Habt ihr Lust, morgen abends zusammen essen zu gehen?“, frage ich Jean-Philippe schließlich nachmittags, „oder seid ihr schon verplant?“
Wir sitzen im Wohnzimmer, Frank mit einem Milchkaffee, ich einem Pfefferminztee, Jean-Philippe kramt gerade in seiner CD-Sammlung.
Langsam sind wir doch etwas irritiert, was wird das wohl für eine Silvester-Nacht geben? Natürlich würden Frank und ich auch alleine losziehen, vermutlich sind die beiden ja eh zu irgend einer Party eingeladen. Aber nett wäre es ja doch, etwas zusammen zu unternehmen. Vielleicht irgendwo lecker essen gehen, danach in die Szene. Zum Beispiel eine Nacht im ‚Broad‘, das zu unserer Lieblings-Diskothek geworden ist, und in die die beiden auch gerne gehen. Nett tanzen, schöne Jungs sehen, und vielleicht das ein oder andere Vergnügen im Kellergeschoss.
Jean-Philippe lugt hinter seinem CD-Regal hervor. Sieht mich erstaunt an. „Nein, wir sind bei meiner Mutter morgen Abend, die feiert mit ihrer Freundin und einigen Verwandten. Ihr kommt doch mit, oder?“
Das ‚oder‘ klingt nicht wie eine Frage, eher so als sei dies doch selbstverständlich.
Ich sehe Frank fragend an. Ein abwartend-ratloser Blick von ihm, ein leichtes Schulterzucken.
„Aber – wir kennen doch da niemanden“, wende ich ein.
Eine private Party ‚en famille‘, auf der wir niemanden kennen, uns doch nur als Eindringlinge fühlen würden? Eine seltsame Vorstellung. Sicher keine heiße Nacht, hört sich eher nach anstrengender Familienfeier an.
Wir überlegen ein wenig hin und her. Unausgesprochene Gedanken und Bedenken. Lädt er uns nur aus Höflichkeit ein? Dringen wir da nicht in eine familiäre Privatheit ein, in die wir nicht hinein gehören? Wollen wir überhaupt solch eine Situation, fühlen wir uns dort nicht unsicher, unwohl? Und – wollten wir nicht eigentlich ausgehen, zusammen Spaß haben?
„Ach komm, was soll denn das. Wir sind doch alle eine Familie. Wirst sehen, meine Mutter ist total nett!“
Das mag schon sein, heißt aber noch nicht, das es für uns ein schöner, ungezwungener Abend wird.
Doch Jean-Philippe, inzwischen bei uns auf dem Sofa, lässt nicht locker. Nimmt mich in den Arm. Drückt mich an sich.
„Na komm. Mir zuliebe!“ Er schaut mir in die Augen. „Und überhaupt, wer weiß wann wir wieder zusammen feiern können!“
Ein entwaffnender Satz, irgendwo zwischen schalkhafter Clownerie und unterdrückter Sorge.
Eine trockene Bemerkung, die mich wehrlos macht. Ich schlucke. Muss irgendwie dieses plötzliche Gefühl von Bestürzung hinunter würgen. Ja, wie viel Zeit haben wir noch mit einander? Wie viel Zeit lässt uns dieses scheiß Virus? Wie viel Zeit zum Feiern, Zeit zum Leben, Zeit für Miteinander? Hat er doch solche Angst? Weiß er mehr als er mir erzählt hat?
Jean-Philippe scheint meine Gedanken lesen zu können. Küsst mich auf die Wange, blickt mich an. Diese Augen, dieser Blick.
„Na also. Keine Widerrede, ihr kommt mit“, beschließt er. „Ich hab meiner Mutter eh schon Bescheid gesagt, für eine Absage wäre’s schon zu spät.“
Er grinst jungenhaft, offensichtlich aus seinem Spaß an der gelungenen Überraschung. Wie sexy ihn dieses Unschulds-Grinsen macht!
„Na okay, wenn wir eh nicht absagen können … Gut, dann kommen wir mit.“ Ich kapituliere nach einem Blick zu Frank, „Danke für die Einladung!“, küsse ihn auf die Wange. „Aber du musst mir sagen, wie wir uns am Fest beteiligen können, ja?“
Er nickt, nimmt nun uns beide beim Arm, freut sich sichtlich.
„Cheri, Frank und Ulli haben zugesagt, sie kommen mit zu meiner Mutter!“, ist das erste was Jean-Philippe abends ruft, als Syriac zur Tür herein kommt.
~
31. Dezember, Silvester. Später Nachmittag. Die meisten bereiten sich jetzt auf den Abend vor, eine Feier mit Freunden, den Besuch einer Party oder einer Disco. Und wir? Seit ungefähr einer Stunde fahren wir, dicht gedrängt in Jean-Philippes kleinem Renault, durch zunehmend grauer werdende Pariser Vorstädte. Nicht ohne die vorherige übliche Kabbelei. „Ah, c’est un bordell, ta voiture“, stöhnte Syriac wieder einmal und nicht grundlos, als wir zum Wagen gingen.
Die grauen Vorstadtkulissen werden zaghaft, so langsam dass es fast schamhaft wirkt, ein wenig bunter. Hochhäuser weichen nach und nach Eigenheimen und Reihenhaus-Siedlungen. Alles hat immer noch diese bizarre Mischung aus französischem Charme und lieblos in die Landschaft gebauten Klötzchen, erinnert an diese typische Spießer-Idylle deutscher Siedlungen am Rande der Großstadt.
In einer Seitenstraße, niedrige Häuser und adrette Vorgärten entsprechen ganz der Vorstellung vom Idyll, parkt Syriac den Wagen. Wir sind da. Ein wenig beklommen steigen Frank und ich aus, halten uns hinter Syriac und Jean-Philippe. Unsicher, was uns erwartet.
„Salut, ich bin Annie, Jean-Philippes Mutter. Ihr seid also Frank und Ulli?“
Wir kommen kaum dazu zu antworten, schon hält sie uns ihre Wange entgegen für die obligatorischen Bussis.
„Kommt herein, fühlt euch wie zuhause.“
Das Haus ist schon gut gefüllt, die beste Freundin, die Schwester mit Mann und Kindern, jeder will mit Hallo und Küsschen begrüßt werden, möchte den von fern angereisten deutschen Besuch bestaunen.
Bevor Verlegenheit aufkommt angesichts noch fehlender Gesprächsthemen, zieht Jean-Philippe uns schon mit in die Küche. Ah, welch ein Duft. Riesige Töpfe auf dem Herd, irgend etwas schmurgelt im Ofen, auf dem Tisch stapeln sich Gemüse. Seine Mutter und ihr Freund stehen am Herd.
„Ah, Topfgucker?“ Sie lacht uns an.
Wir bedanken uns nochmals für die Einladung, stellen die mitgebrachten Getränke ab.
„Ihr mögt doch Austern, hab ich gehört?“
„Ach ja, schon, durchaus“ grinst Frank.
„Na klasse, dann bin ich beruhigt.“ Frank strahlt, Annie lächelt verschmitzt, beinahe ein wenig verschwörerisch – ganz so wie Jean-Philippe mich manchmal so unwiderstehlich anschaut, denke ich.
„Hmmm, das riecht unglaublich lecker!“ Frank schaut durch das Ofenfenster. „Was gibt es?“
„Wird nicht verraten – und: Finger weg!“, erwidert Annies Freund streng dreinschauend. Frank stutzt, Annies Freund lacht jedoch sofort, „kleiner Spaß.“ Er führt Frank von Topf zu Topf, alle Deckel werden kurz gelüftet, ein kleiner illustrierter Spaziergang durch das für den Abend geplante Menu veranstaltet.
„Du bist also Ulli. Jean-Philippe hat mir schon viel von dir erzählt!“ Annie sieht mich aufmunternd an. Ich frage mich, was er wohl so alles erzählt, was hoffentlich verschwiegen haben mag.
Einige Höflichkeitsfloskeln werden gewechselt, die Jean-Philippe bald unterbricht. „Ulli ist auch seropos“. Kurz und bündig, direkt. Seropos, die Verniedlichung des schön klingenden und doch so vernichtenden Wörtchens seropositiv. Es wirkt als hätte Frank gerade auf die Austern gekotzt. Kaltes Schweigen steht für Sekunden im Raum.
Erschreckt sehe ich auf. Überrascht. Nicht nur ob Jean-Philippes völlig unfranzösischer und ungewöhnlicher Direktheit. Werde ich rot? Verlegen sehe ich erst Jean-Philippe an, dann Annie. Wie reagiert sie?
Annie blickt mich an, mustert mich, eindringlich, ohne ein Wort. Ist es eher traurig oder mitleidig, wie sie mich ansieht? Ist sie brüskiert, irritiert von der plötzlichen Mitteilung in mitten des Smalltalks?
Sie erwidert Jean-Philippes Direktheit mit keinem Wort. Stattdessen höre ich sie nach einer kurzen, mir ewig scheinenden Pause sagen „Bis zum Essen dauert’s noch ein wenig. Phi-Phi, zeigst du deinem Besuch derweil das Haus?“
Phi-Phi also, ich grinse. Auch erleichtert darüber, dass nun keine Lektion in „warum du denn“, „wie konntest du nur“ und „warum hast du denn“ folgt. Schwalle interessierter und doch wenig verdeckt vorwurfsvoller Fragen, wie ich sie schon zu oft gehört habe.
PhiPhi, bestimmt sein Kindername. PhiPhi, wie melodisch das klingt aus ihrem Mund. Wie mag er wohl ausgesehen haben, mein Jean-Philippe, als Knirps, als kleiner Junge, als Teenager? Ich muss ihn gelegentlich mal nach Photos aus seiner Jugend fragen.
Nach dem Aperitiv. Kleine Grüppchen haben sich gebildet, stehen beieinander, unterhalten sich angeregt. Frank und ich stehen etwas abseits zusammen, schauen in den Garten. Ein Blick, ja, wir fühlen uns beide unwohl. Seltsam, so in eine fremde Familien-Feier zu platzen. Trotz der Einladung fühlen wir uns fremd, haben das Gefühl zu stören in dieser vertrauten Runde. Jean-Philippe ist längst ins Gespräch vertieft mit seiner Mutter und deren bester Freundin. Wir spielen ein wenig mit seinem kleinen Bruder, der aufgeregt durch den Raum tobt, für ihn sind wir als Fremde die Attraktion des Abends.
Kurz nach neun. Annie lugt aus der Küche hervor, klatscht in die Hände. „Zu Tisch alle, wir können essen.“
Jean-Philippe kommt schon auf uns zu, „setzt ihr euch hier?“. Er weist auf zwei Stühle, zwar etwas abseits von Syriac und ihm, aber immerhin sitzen Frank und ich neben einander.
Annie und ihr Freund tragen die Vorspeise herein, eine große Platte – Berge von Austern. Sie grinst Frank und mich an, „ich hab gehört, unser Besuch aus Deutschland ist so gerne Austern?“
Frank schaut erst ein wenig schüchtern, ein Blick Richtung Jean-Philippe, der unschuldig in eine andere Richtung blickt. „Ja, schon. Sehr gerne!“
„Na, dann langt alle kräftig zu! Guten Appetit!“
Einige Stunden später. Berge leerer Austernschalen türmen sich auf dem kleinen Tisch nebenan zwischen leeren Weiß- und Rotwein-Flaschen, auch der köstliche Burgunderbraten, der zuvor stundenlang im Ofen geschmort hat, ist längst verzehrt. Schüchternheit und Fremdeln sind gewichen, längst duzen wir uns mit allen am Tisch, mit Annies bester Freundin, ihrem Freund, einer Nachbarin, und natürlich mit Annie selbst.
Frank stößt mich sachte unter dem Tisch an. „Du, ist schon zwölf durch“ höre ich ihn leise flüstern. Ich blicke unauffällig auf meine Uhr. Stimmt, zehn nach zwölf. Und nun? In Deutschland würden wir uns jetzt alle in den Armen liegen, ein Glas Sekt in der Hand, ein frohes neues Jahr wünschen, während ringsum langsam die Geräuschkulisse der Feuerwerke immer infernalischer würde. Aber hier? Munteres Plaudern bei Tisch, niemand schaut auf die Uhr, nichts tut sich.
Ich zucke mit den Schultern, „ach, lass uns einfach abwarten“. Gebe ihm einen schnellen Kuss, „frohes Neues Jahr, mein Schatz!“. Niemand in der Runde bemerkt unseren stillen Neujahrsgruß.
Die Zeit vergeht. „Ach nicht, Mama!“, versucht Jean-Philippe seine Mutter gerade daran zu hindern, eine weitere amüsante Geschichte aus seiner Kindheit zu erzählen. „Na, lass mich doch,“ frotzelt sie zurück, „Ulli und Frank kennen die doch sicher noch nicht.“
Ihr Freund eilt Jean-Philippe zu Hilfe. „Na,“ er schaut auf die Uhr, „ich glaube wir stoßen mal an, was meint ihr?“ Er holt einige Flaschen Champagner aus der Küche.
Wenig später, Bussis hier, Bussis da mit Menschen, die uns noch wenige Stunden zuvor völlig fremd waren, „frohes neues Jahr!“.
„Na endlich doch noch“, grinst Frank, „um kurz vor eins“. Wir küssen uns, nun noch einmal ‚offiziell‘, „alles Gute für das neue Jahr, mein geliebter Schatz“. Jean-Philippe kommt auf mich zu, ich umarme ihn herzlich, küsse auch ihn. „Alles Gute für 1990, mein Lieber!“ „Dir auch, und – pass gut auf dich auf“. „Na, du auch auf dich“, erwidere ich grinsend. Er zwinkert vertraut, als wolle er sagen ‚wir passen schon beide auf einander auf, nicht wahr?‘
Annie, ganz gute Gastgeberin, klatscht in die Hände, „kommt, wir rücken die Tische beiseite. Jean-Philippe, machst du ein wenig lustigere Musik?“ Tische und Stühle wandern in eine Hälfte des Zimmers, so dass in der anderen rasch eine kleine Tanzfläche entsteht. Jean-Philippe, seinen kleinen Bruder auf dem Schoß, sitzt in der Ecke, macht Musik, kramt in seinen CDs. Die Nacht wird lang …
„Na, das ist doch ein ganz amüsantes Silvester geworden, nicht wahr?“
Frank und ich sind der ausgelassenen Stimmung auf die Terrasse entflohen, ein wenig Ruhe, Luft schöpfen nach all der Tanzerei.
„Ja, hättest du aber anfangs auch nicht erwartet, oder?“
„Stimmt, mir war ganz schön unwohl zu Anfang. Ist aber doch ziemlich nett geworden, oder?“
Frank nickt nur, nimmt mich in den Arm.
„Ist das denn für dich auch okay hier? Ich meine auch so mit Jean-Philippe?“, frage ich ihn, während wir in den Sternenhimmel blicken.
Wieder nickt er nur. Gibt mir einen Kuss. „Ach, wir sind schon so ein Paar, mein Schatz! Ich liebe dich über alles!“
Kurz vor drei, die Stimmung ist ein wenig ruhiger geworden, in einer seltsamen Mischung von aufgekratzt, angeheitert und müde vom langen Abend sitzen alle in kleinen Grüppchen im Wohnzimmer verteilt.
„Na, ihr Hübschen, geht’s euch gut?“ Jean-Philippe setzt sich zwischen uns, legt seine Arme um Frank und mich.
„Ja, klasse Abend, ist echt schön bei euch!“
Er strahlt. „Sollen wir so langsam mal aufbrechen?“
Ich sehe Frank an, der nickt. „Ja gerne. Aber wie …“
Jean-Philippe ahnt schon meine Frage, „Syriac hat kaum was getrunken, er kann noch fahren.“
Nun ja, dieses ‚kaum was getrunken‘ ist recht relativ, aber was soll’s, wir sind ja in Frankreich, es ist gerade 1990, wir hatten einen schönen Abend, sind glücklich.
Müde fallen wir kurz nach vier Uhr morgens am 1. Januar 1990 ins Bett.
~
Wenige Tage später. Zurück in Köln. Zurück im Büro.
Was für eine kuriose Situation. Beinahe jeder der Kolleginnen und Kollegen erzählt von der geilen Silvester-Nacht in Berlin, an und auf der Mauer, die ganze Stadt eine riesige Party. Geschichten von Geschichte, Jahrhundertereignis, ‚das hättest du erleben müssen‘ und ‚da muss man einfach mit dabei gewesen sein‘.
Und ich? Verbringe zusammen mit meinem Freund den Jahreswechsel bei einem Lover in Paris. Habe außer Verliebtheit, netter Vorstadt-Familie und leckerem Essen kaum Erwähnenswertes zu berichten. Privates Glück statt Weltgeschichte. Nur kurz nehmen sie mehr oder minder offen desinteressiert meinen Paris-Bericht zur Kenntnis, kehren bald zu ihren bewegenden Berliner Geschichten zurück, dem zentrale Gesprächsstoff der nächsten Tage.
Grotesk erscheint mir die Situation. Grotesk ihre alles andere ignorierende, vor Begeisterung überbordende „Berlin Berlin“-Euphorie. Grotesk bis peinlich die immer wieder kolportierten Geschichten vom „Ossi im Glück“ oder „Wessi auf der Mauer“. Grotesk wohl aber auch mein Rückzug ins private Glück, in die Pariser Vorstadt-Idylle, während ringsum Geschichte geschrieben, gefeiert wird. Und dennoch, grotesk wie es scheinen mag, bin ich mir in diesen Tagen sicher, das beste Silvester erlebt zu haben. Dieses tiefe Gefühl, ‚einen so schönen Jahreswechsel wie ich könnt ihr da gar nicht erlebt haben‘.
~
Einige Tage mit dir
1. Conti & co.
2. Sternenhimmel
3. Fühlt euch wie zuhause
4. Tristesse in Pigalle
5. Allooo, isch Jean-Philippe Muutti
6. Le Vaudeville
7. Wo bin ich?