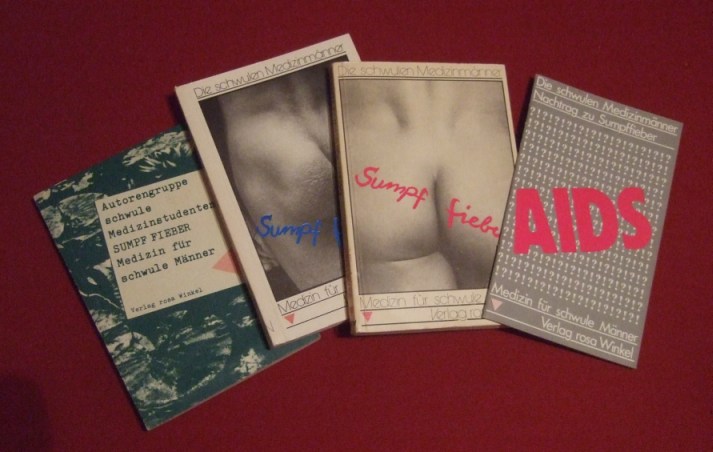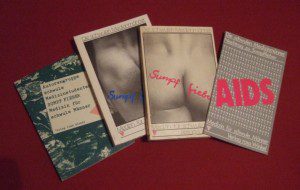Mit dem Thema „sexuelle Zufriedenheit“ ( sexual happiness ) bei schwulen und bisexuellen Männern habe ich mich in einer zweiteiligen Artikel-Miniserie für das Internetportal queer.de auseinander gesetzt.
Der erste Teil erschien dort am 18.03.2013: Französisch? Zypriotisch? Schwuler Sex in Europa:
Teil 2 “ Sexual Happiness (2): Top oder Flop? Schwuler Sex in Deutschland“ erschien bei queer.de am 22.3.2013.
Sexual Happiness (Teil 1): Französisch? Zypriotisch? Schwuler Sex in Europa
Schwule haben viel Sex und sind ständig bereit, so das Klischee. Aber haben wir auch guten Sex? Unsere Sex-Zufriedenheit im europäischen Vergleich.
Von Ulrich Würdemann
Unzufrieden mit seinem Sexleben zu sein, das ist offenbar ein in ganz Europa weit verbreitetes Phänomen. Das ergibt sich aus den Zahlen des Projekts EMIS, bei dem 2010 in 38 Staaten Männer, die mit Männern Sex haben, zu ihrem Liebesleben Auskunft gaben.
Immerhin 38,6% aller befragten schwulen und bisexuellen Männer der europaweiten EMIS-Befragung (180.000 ausgefüllte Fragebögen!) gaben an, nicht mit ihrem Sexleben zufrieden zu sein! Die Gründe für diese sexuelle Unzufriedenheit sind vielfältig, reichen von Lebensalter über Bildungsniveau über die Wohnortgröße bis zur Frage, wie offen man(n) mit seinem sexuellen Interesse an Männern umgeht.
European Sex-Umfrage: And here are the results…
- Je jünger, desto zufriedener: im Vergleich zur Altersgruppe 25 bis 39 Jahre (1,0) haben MSM über 40 Jahre ein leicht (1,02) erhöhtes Risiko sexueller Unzufriedenheit, während es bei jungen MSM unter 25 Jahren deutlich (0,92) niedriger ist.
- MSM mit einem mittleren Bildungs-Niveau haben ein höheres Risiko sexueller Unzufriedenheit als Männer mit niedrigem oder hohem Bildungsniveau.
- Die Provinz macht (sexuell) eher nicht glücklich: Bei Männern, die in kleinen Städten sowie in Dörfern leben, ist sexuelle Unzufriedenheit häufiger als bei Männern in Städten über 100.000 Einwohner.
- Männer, die sich noch nie in ihrem Leben auf HIV hatten testen lassen, äußerten deutlich öfter, sexuell unzufrieden zu sein, als HIV-positiv getestete Männer. HIV-negativ getestete Männer hatten wiederum ein deutlich niedrigeres Risiko sexueller Unzufriedenheit.
- Männer, die sich selbst als bisexuell bezeichneten, waren mit geringerer Wahrscheinlichkeit sexuell unzufrieden als Männer, die sich als homosexuell oder schwul bezeichneten, diese wiederum waren seltener sexuell unzufrieden als diejenigen Männer, die keinen oder einen anderen als die drei bisherigen Begriffe für sich verwenden.
- Fickt sich’s mit Coming-out zufriedener? Ja. Im Vergleich zu Männern, die mit ihrem Schwulsein offen allen oder nahezu allen Menschen in ihrem Umfeld gegenüber waren, war das Risiko sexueller Unzufriedenheit signifikant höher selbst bei Männern, bei denen über die Hälfte des Umfelds ‚es‘ wusste, und bei denen, die niemandem von ihrem Begehren für Männer erzählten, war das Risiko sexueller Unzufriedenheit mehr als doppelt so hoch.
[Alle Werte berücksichtigen bereits etwaige Unterschiede hinsichtlich Alter, Ausbildung, Wohnortgröße, bisherigen HIV-Tests, sexueller Identität, Offenheit im Umgang mit dem eigenen sexuellen Interesse an Männern und Quelle des Fragebogens (AOR, adjusted odds ratio)]
Es mag eine Vielzahl von Gründen geben, die dazu beitragen, dass jemand mit seinem Sexleben unzufrieden ist. Für die in Europa befragten schwulen und bisexuellen Männer allerdings gab es einen Grund, der klar heraus ragt: in 35 der 38 teilnehmenden Staaten war der meist genannte Grund sexueller Unzufriedenheit: sich eine beständige sexuelle Beziehung mit einem Partner zu wünschen, diese aber nicht zu haben.
Die Sehnsucht nach einer stabilen sexuellen Beziehung wurde selbst häufiger genannt als der Wunsch nach mehr Sex oder nach mehr Sexpartnern – und auch häufiger als der Wunsch nach mehr sexuellem Selbstvertrauen. Typischerweise war ein Viertel der Männer in jedem Land deswegen sexuell unzufrieden, weil sie Single sind.
Französisch macht glücklich? Oder: viel Arbeit für die EU!
Innerhalb Europas schwankt der Anteil der schwulen und bisexuellen Männer, die unzufrieden mit ihrem Sexleben sind, ausgesprochen stark.
Ausgesprochen hoch ist der Grad an sexueller Unzufriedenheit bei schwulen und bisexuellen Männern in Bosnien-Herzegowina (61,3%), Mazedonien (55,4%) und Zypern (53,7%), dicht gefolgt bemerkenswerterweise von Schweden mit 47,8%. MSM in Deutschland sind mit 38,4% annähernd im Durchschnitt aller Befragten (38,6%), während es schwulen wie bisexuellen Männern in Belgien (31,7% unzufrieden), den Niederlanden (30,7%), Spanien (31,9%) und der Schweiz (31,2% unzufrieden) scheinbar sexuell recht gut zu gehen scheint. Und am besten scheint es – wer hätte es vermutet – den Franzosen zu gehen. Nur 27,8% gaben an: „Nein, ich bin nicht zufrieden mit meinem Sexleben.“
Nun mag man gegen diesen Ländervergleich einwenden, nicht aus allen Staaten nahmen Männer im gleichen Alter teil – und sicherlich ist z.B. der Anteil offen schwul lebender MSM in manchen Staaten höher als in anderen. Die Forscher haben dies berücksichtigt: Sie haben diese Unzufriedenheits-Werte zur besseren Vergleichbarkeit justiert (AOR, adjusted odds ratio) nach Alter, Ausbildung, Wohnortgröße, bisherigen HIV-Tests, sexueller Identität, Offenheit im Umgang mit dem eigenen sexuellen Interesse an Männern und auch nach Quelle des Fragebogens (z.B. Internetsite, Magazin etc.). Das Ergebnis veränderte sich hierdurch nicht gravierend. In Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Zypern und Schweden ist sexuelle Unzufriedenheit am weitesten unter MSM verbreitet, MSM in Deutschland geht es mit einem Wert von 0,85 leicht besser als dem Referenz-Mittelwert Großbritannien (1,0), und die geringsten Werte an Unzufriedenheit stammen aus Spanien, Portugal, der Schweiz und Frankreich.
In welchem Staat ein Mann, der sexuell Männer begehrt, in Europa lebt, ist damit der wichtigste Faktor für das Risiko, sexuell unzufrieden zu sein! Das Risiko eines schwulen oder bisexuellen Mannes, unzufrieden mit seinem Sexleben zu sein, ist in Bosnien-Herzegowina über zweieinhalb mal so hoch wie in Frankreich!
Unzufriedenheit weit und breit?
Wir fassen zusammen: Sexuelle Unzufriedenheit ist unter Männern, die Sex mit Männern haben, in Europa weit verbreitet. Für Männer, die nicht offen mit ihrem sexuellen Interesse für andere Männer umgehen, ist das Risiko sexueller Unzufriedenheit deutlich erhöht, ebenso für Männer die sich nicht als homosexuell oder schwul bezeichnen. Wer in Kleinstädten oder Dörfern lebt, hat ein höheres Risiko sexueller Unzufriedenheit, ebenso Männer die sich noch nie auf HIV haben testen lassen.
Unzufriedenheit mit dem eigenen Single-Sein, die Sehnsucht nach einer stabilen sexuellen Beziehung sind für schwule und bisexuelle Männer in allen Staaten Europas ein wichtiges Thema und Quelle sexueller Unzufriedenheit. Werden unsere derzeitigen Szenen, ob Bars und Kneipen, Saunen und Partys, Internetportale und Magazine dieser Sehnsucht gerecht?
Innerhalb Europas sind die Unterschiede sexueller Zufriedenheit bei schwulen und bisexuellen Männern groß. Bis alle schwulen und bisexuellen Männer so zufrieden mit ihrem Sexleben sind wie die Franzosen, ist es offensichtlich noch ein weiter Weg. Eine Europäische Union, die sich zum Ziel setzt, allen Europäern gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen, hat auf dem Gebiet sexueller Zufriedenheit schwuler und bisexueller Männer also noch viel zu tun!
.
Weitere Infos zu EMIS / Fußnoten
Die „sexual happiness“, übersetzt als ‚Zufriedenheit mit dem eigenen Sexleben‘, ist bis 2010 in Befragungen in Deutschland und Europa nie ein Kriterium gewesen. Erstmals überhaupt wurde sie im Rahmen des europaweiten Projektes EMIS [2] (European MSM Internet Survey) sowie der im Rahmen von EMIS stattfindenden deutschlandweiten Befragung Schwule Männer und Aids (SMA) thematisiert [1].
„Sind Sie mit Ihrem Sexleben zufrieden?“, wurden die Teilnehmer im deutschen EMIS-Fragebogen gefragt. Im englischen Original heißt es „Are you happy with your sex life?“, die Autoren empfanden für die deutsche Übersetzung „glücklich“ als zu pathetische Formulierung und entschieden sich für „zufrieden“. Die Frage konnte von den Teilnehmern mit ‚ja‘ und ’nein‘ beantwortet werden, und in einem zweiten Schritt konnten sie begründen, warum sie nicht mit ihrem Sexleben zufrieden sind.
Für die Auswertung standen insgesamt Daten von 180.000 schwulen und Bi-Männern (MSM, Männer die Sex mit Männern haben) aus 38 Ländern in Europa zur Verfügung. Aus Deutschland konnten über 14.000 Fragebögen EMIS und über 40.000 Zusatzfragebögen SMA ausgewertet werden.
[1] „Sexual happiness“. In: Michael Bochow, Stefanie Lenuweit, Todd Sekuler, Axel J. Schmidt: „Schwule Männer und HIV/Aids: Lebensstile, Sex, Schutz- und Risikoverhalten“. Aids-Forum DAH Nr. 60, Berlin Dezember 2012 [Anmerkung: Die Befragung „Schwule Männer und Aids“ (SMA) findet bereits seit 1987 statt. Aids-Forum DAH Nr. 60 berichtet über die Befragung 2010, die im Rahmen des Projektes EMIS stattfand]
[2] „Sexual Unhappiness“ in: „The EMIS Network: The European MSM Internet Survey 2010 -Descriptive report of survey results“, Stockholm, ECDC; 2013 (forthcoming / Veröffentlichung geplant) s.u.
[3] Weltgesundheitsorganisation WHO: Sexuelle und reproduktive Gesundheit (Definition)
[4] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA: Definitionen von sexueller und reproduktiver Gesundheit
.
Aktualisierung
27.05.2013: Der 200-seitige EMIS-Schlußbericht (Autor: „The EMIS network“, Herausgeber: „European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)“) ist inzwischen publiziert und steht als Download zur Verfügung auf http://www.emis-project.eu/. Zudem sind für ausgewählte Staaten EMIS-Länder-Reports verfügbar: Russland, Norwegen, Österreich, Schweiz, Irland (Republik Irland sowie Nord-Irland), Estland, Dänemark, Deutschland, and Lettland. EMIS -Zusammenfassungen sind erschienen für England, Schottland, Wales und Nord-Irland.
6.10.2019: Ergebnisse der Nachfolge-Studie EMIS 2017 zu Sexualverhalten und Gesundheit von rund 128.000 Männern, die Sex mit Männern haben: „EMIS-2017: The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey“ (PDF, englisch)
.