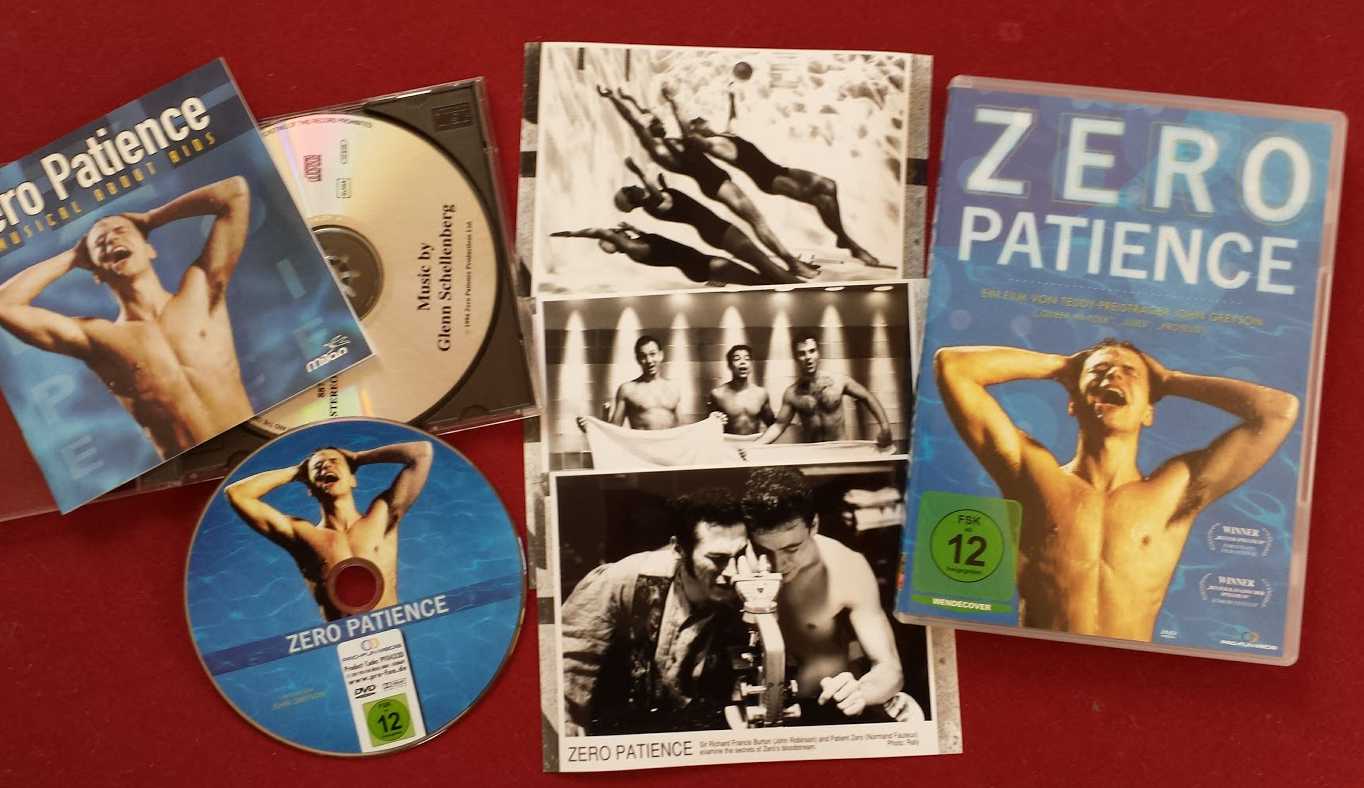Der Regisseur Wolfgang Petersen verfilmte 1977 den autobiographischen Roman ‚Die Konsequenz‘ von Alexander Ziegler, produziert von Bernd Eichinger. Ein schwules Liebesdrama in schwarz/weiß mit Millionen- Publikum und zugleich mehrfacher Skandal.
„Aha, sie sind also der Unzüchtler …„
… die Worte mit denen Martin Kurath im Knast begrüßt wird setzen direkt den Ton des Films. Eine autobiographische Geschichte nach dem gleichnamigen Roman von Alexander Ziegler.
„homoexuell sein ist ein Fluch, weil den Leuten immer etwas Neues einfällt um die fertig zu machen“
(Kurath)
Der Film ist ein Frühwerk des Produzenten Bernd Eichunger und des Regisseurs Wolfgang Petersen. Petersen schrieb hier (wie sonst nur sehr selten bei seinen Filmen) auch das Drehbuch.
Immer wieder Thema: der Gedanke, Schwule würden andere zur Homosexualität verführen.
Thomas Manzoni setzt sich zu Kurath.
„Mein Alter mag dich nämlich nicht. Er hat was gegen Schwule.„
Kurath antwortet „Trotzdem sitzen wir hier oben zusammen?„
„Hat er dich schon rumgekriegt„,
fragt Manzonis Vater seinen Sohn entrüstet.
Und mit den Worten
„versau‘ mir meine Gruppe nicht“
begrüßt der Gruppenleiter Manzoni im Knast, und ergänzt
„wir werden schon einen Mann aus dir machen„.
„ach so einer sind sie also. einer der sene Lustknaben zur schle schickt.“
Tomas Chef im Geschäft zu K
Die Protagonisten zerbrechen im Film letztlich – nicht aufgrund ihres Schwulseins, sondern an Hass und Ignoranz der Gesellschaft.
Ist die einzige Lösung aufzugeben?
Die Konsequenz – Roman 1975
Vorlage des Films ist der gleichnamige autobiographische Roman (1975) Die Konsequenz von Alexander Ziegler.
Die Handlung des Romans spielt im Jahr 1974. Ziegler verarbeitet hierin seine eigenen Haft- Erfahrungen in Lenzburg. Der Roman war bei seinem Erscheinen ein Erfolg.
Die Konsequenz – Film 1977
Roman- Autor Alexander Ziegler arbeitete auch an der Entstehung des Films persönlich mit, insbesondere war er beteiligt am Drehbuch gemeinsam mit Wolfgang Petersen und fungierte als Darsteller des Häftlings Lemmi.
Aus künstlerischen Erwägungen heraus drehte Petersen den Film in schwarz-weiß.
Die Konsequenz – Mediengeschichte
‚Die Konsequenz‘ wurde bei den Hofer Filmtagen am 29. Oktober 1977 uraufgeführt. Aus dem Pubhlikum gab es geteilte Reaktionen – von Beifall bis deutliche Ablehnung. Der Film erhielt das Prädikat ‚wertvoll‘ und wurde 1977 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet.
Dennoch konnte der Film nicht in der ursprünglich geplanten Version erscheinen.
Bei der Fernseh- Erst-Ausstrahlung in der ARD am 8. November 1977 um 21:15 Uhr boykottierte der Bayerische Rundfunk die Sendung, zeigte als Ersatz stattdessen die Verfilmung des Bauern-Melodrams ‚Der Sternsteinhof‘.
Zur Begründung teilte der BR mit
„Der Bayerische Rundfunk sieht in dem Film, unbeschadet seiner sonstigen Qualitäten und seiner guten Absichten, die Vorurteule und Voreingenommenheit gegenüber Homophilen in der Bevölkerung verstärkt.“
(Pressemitteilung Bayerischer Rundfunk, 8.11.1977)
Zudem wurde auf vermeintliche Verstöße gegen zwingende Vorschriften des Gesetzes über den Bayerischen Rundfunk verwiesen.
Anläßlich der Erstausstrahlung des Films ‚Die Konsequenz‘ wiesen Medien darauf hin, der Film suche „keine Provokation„, beziehe seine Wirkung aus der „Selbstverständlichkeit, mit der sich der Film auf die Gefühlswelt der beiden Männer einläßt“ (Zeit) oder sahen den Film als „Romanze voller heikler Poesie„, die „eher leise rebelliert“ (Spiegel).
Für den Comic-Zeichner Ralf König war der Film „ein erschütterndes Schlüsselerlebnis“ – wegen der Botschaft ‚Schwulsein ist ein großes Drama, ist tragisch‚.
Annähernd gleichzeitig zur Fernseh-Erstausstrahlung kam ‚Die Konsequenz‘ ab 2. Dezember 1977 in die Kinos.
Der Bayerische Rundfunk strahlte den Film schließlich doch aus – erstmals 20 Jahre (!) später, am 17. März 1999.
2022 erschien der Film erstmals auf BluRay (mit verbessertem Ton).
.
Der ominöse Herr Krauthagen von der CDU
Im Film bringt Kurath Manzoni in Kontakt mit dem deutschen Politiker und Abgeordneter Clemens Krauthagen. Der könne ihm eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland besorgen. Krauthagen, den sie in seinem Privathaus besuchen, macht Annäherungsversuche. Manzoni berichtet später, Bedingung für die Aufenthaltsgenehmingung sie gewesen, dass er ‚Freund‘ des Krauthagen werde, ihn begleite.
Für die Figur des Krauthagen gab es ein reales ‚Vorbild‘.
Hinter ‚Krauthagen‘ solle sich ein bekannter [bisher öffentlich weiterhin nicht dechiffrierter] Hamburger CDU-Politiker verbergen, berichtet Jörn Voss 1977 im ‚Stern‘ (zitiert von Rosenkranz/Lorenz in ‚Hamburg auf anderen Wegen‘, S. 221).
Dieser, verheiratet, stockschwul, besäße ein abgelegenes Haus im Schwarzwald. 1969 habe er gegen die Reform des Paragraphen 175 gestimmt. Mit einem hohen Scheck solle er das Erscheinen des Buches zu verhindern versucht haben.
Alexander Ziegler selbst geht hierauf (1988 post mortem publiziert) direkt ebenfalls ein. Journalisten der ‚Bild‘ hätten die Figur Krauthagen dechiffriert.
Helmut Kohl selbst habe ihm auf seine Nachfrage in einem persönlichen Schreiben im Juli 1975 versichert, „kein Politiker der CDU [werde] aufgrund seiner privaten Neigungen diskriminiert oder benachteiligt„.
Alexander Ziegler (1944 – 1987)
Der Schweizer Schauspieler und Schriftsteller Alexander Ziegler (1944 Zürich – 1987 Zürich) wurde 1966 wegen Vergehens gegen §175 zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. In der Haftanstalt schrieb Ziegler seinen ersten autobiographisch geprägten Roman ‚Labyrinth‘.
1971 bis 1979 war Ziegler Chefredakteur der Homosexuellen-Zeitschrift ‚Du & Ich‘ (im November 1969 erstmals erschienen als ‚du + ich – Magazin für Freunde von heute‘).
Ziegler lebte mit seinem Freund Kurt Wernli in Stäfa (nahe Zürich).
Alexander Ziegler starb am am 11. August 1987 nach einer selbst verabreichten Überdosis Schlaftabletten.
.
.
Für die Darstellung Schwuler im Film (bzw. im Mainstream- Film und daraus -TV) mag ‚Die Konsequenz‘ ein Meilenstein gewesen sein. Für mich nicht.
Für mich war ‚Die Konsequenz‘ damals alles andere als ein ‚Schlüsselerlebnis‘. Ich war achtzehn, als Petersen den Film drehte. Wann ich ihn zum ersten Mal sah, kann ich nicht genau erinnern.
Ich hätte damals versucht sein können, mich mit der Figur des ‚Thomas‘ zu identifizieren, zumal Darsteller Hannawaldt nur unwesentlich jünger als ich ist.
‚Die Konsequenz‘ atmete für mich eher den Geist der 60er Jahre, war sehr weit weg von meinen ersten Versuchen, meinen schwulen Weg zu finden. Wies für mich zudem in die falsche Richtung, ich empfand den Film als rückwärtsgewandt, mindestens als nicht emanzipationsfördernd. Weinerlich.
.